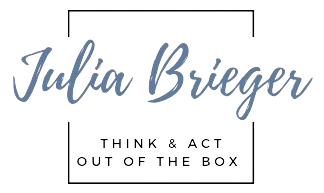Der Begriff des Coaches lässt sich in der ungarischen Sprache auf das Wort „Kutsche“ zurückführen. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Ausdruck Coach (meist scherzhaft) für private Tutoren von Studenten verwendet. Die Bezeichnung Coach für eine Person, die, ähnlich wie die Kutsche, durch Training und (körperliche) Übung einer anderen Person, dem Coachee (oder in der Analogie der Kutsche dem Fahrgast) eine Möglichkeit gibt, um sich schneller von A nach B zu bringen etablierte sich Ende des 18. Jahrhunderts im Sport.
Der Begriff Coaching findet bereits seit geraumer Zeit auch über den Sport hinaus Anwendung. Zu den ersten Nutzern von Coaching abseits des Sports gehörten vor allem Führungskräfte und Mitarbeitende aus größeren Firmen. Dabei lag der Fokus bei der Betreuung der Mitarbeitenden auf der Verbesserung der Motivation und der fachlichen Kompetenz. Ein gesteigertes gesellschaftliches Interesse an psychologischen Sachverhalten in Bezug auf Motivation, Zufriedenheit und Entwicklung von Mitarbeitenden verhalfen dem Coaching als Methodik zu zunehmender Bekanntheit.
Mittlerweile kristallisieren sich zwei sehr wesentliche Bereiche heraus, in denen das Coaching Anwendung findet – Business- und Life-Coaching.
Das Business-Coaching richtet sich in erster Linie auf Herausforderungen des beruflichen Umfelds. Beispiele hierfür sind Karriere- oder Bewerbungs-Coaching, der Schritt in die Selbstständigkeit, die Entwicklung von Führungskompetenzen oder allgemein die Fragestellung der Arbeitsform.
Beim Life-Coaching geht es um alle Lebensbereiche außerhalb der Arbeit. So werden im Life-Coaching beispielsweise Beziehungsthemen wie das Finden eines Partners, das Überwinden von Beziehungskrisen oder mögliche, friedliche Trennungen behandelt. Auch die Familie betreffende Themen wie Eltern-Sein, das Zusammenleben als Familie oder der Umgang mit Trauerfällen innerhalb der Familie können im Rahmen von Life-Coaching erörtert werden. Darüber hinaus können auch persönliche Zielsetzungen wie das Loswerden von Ängsten oder unliebsamen Gewohnheiten sowie die Steigerung des Selbstbewusstseins angegangen werden.
An den zuvor genannten Beispielen für Coaching-Themen wird deutlich, dass es allgemein gesprochen zwei Anlässe für die Anwendung von Coaching gibt: Entwicklungscoaching oder Krisen- bzw. Problemcoaching. Dabei hat das Entwicklungscoaching eine Verbesserung oder die Entwicklung von Kompetenzen zum Ziel. Häufig zielt dies auf eine allgemeine Haltung ab und ist nicht auf einen konkreten Fall begrenzt. Ein Entwicklungscoaching wird somit in Anspruch genommen, bevor ein massives Problem entsteht und kann daher als präventive Maßnahme gesehen werden. Das Krisen- oder Problemcoaching hingegen hat ein konkretes Defizit als Ausgangspunkt und beabsichtigt, eine ältere oder akute Krise oder ein Problem als Chance für Wachstum und Weiterentwicklung zu nutzen.
In meinen Augen ist eine klare Abgrenzung von Coaching gegenüber (Psychologischen) Therapien sehr wichtig. Das Coaching ist keine Therapie und ersetzt in keinem Fall eine erforderliche psychologische Therapie. Der Einsatz von Coaching setzt eine psychische Gesundheit voraus.
Coaching ist eine ergebnisorientierte Methodik, es geht darum ein Ziel zu erreichen. Dieses gibt immer und allein der Coachee vor. Um in der Analogie der Kutsche zu bleiben, nennt der Fahrgast (Coachee) das Ziel der Fahrt. Der Coach sorgt durch das Coaching, genau wie der Kutscher für ein schnelleres Erreichen des Ziels – beides stellt eine Art Beschleuniger auf dem Weg zum Ziel dar. Ein Coach löst nicht die Probleme des Coachees, sondern ermächtigt diesen, selbst Möglichkeiten zu identifizieren, benennen und zu ergreifen. Den Weg gehen, muss der Coachee im Anschluss an das Coaching selbst. Ein Coach arbeitet aus der Haltung heraus, dass der Coachee die Lösung kennt und er (der Coach) diese dem Coachee nicht geben muss. Im Coaching wird immer davon ausgegangen, dass nur der Coachee die für Ihn beste Lösung findet. Das Coaching vermag somit neue Sichtweisen und Möglichkeiten sichtbar zu machen, um gesetzte Ziele zu erreichen oder Probleme zu bewältigen. Das heisst, der Coach befähigt den Coachee seine Ziele selbst in kürzerer Zeit zu erreichen.
Coaching basiert auf Selbstverantwortung und den Mechanismen der Reflexion. Eigene Denkmuster, Verhalten und Handlungen werden reflektiert und weiterentwickelt.
So wie es eine große Varianz von Themen für Coachings gibt, so gibt es eine Vielzahl von Coaching Methodiken und Ansätzen.
Der Ansatz nach dem ich persönlich arbeite ergibt sich aus einer Mischung des sogenannten Systemischen Coachings und des Kontextuellen Coachings. Dabei identifiziere ich gemeinsam mit dem Coachee wie dieser sich selbst in der Erreichung seiner Ziele im Weg steht. In Coaching-Dialogen leite ich den Coachee an, diese durch innerste Überzeugungen oder nicht funktionale Zusammenhänge (Kausalitäten) hervorgerufenen Blockierungen zu erkennen und aufzulösen. Mein Vorgehen im Coaching-Dialog basiert größtenteils auf Frage- und Visualisierungstechniken und verfolgt die Absicht der Transparenz.
Es gibt noch keine allgemein gültigen Qualitätsmerkmale für Coaching. Daher ist es wichtig, den persönlichen Fit zu überprüfen. Meist findet man dies sehr gut im persönlichen Gespräch heraus im Rahmen der Zieldefinition für das Coaching heraus.